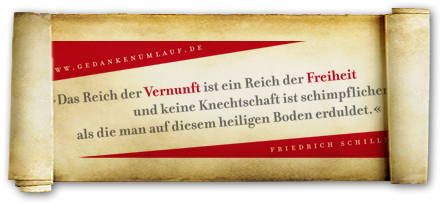In keiner Stadt verweilte Friedrich Schiller länger als in Jena. Von den fünf Häusern, die der Dichter und Professor in seinen zehn Jahren (1789 bis 1799) in Jena bewohnte, ist heute nur sein Gartenhaus – in dem unter anderem sein „Wallenstein“ entstand – als Museum erhalten. Trotzdem findet man in ganz Jena auch heute noch seine Spuren: Die Schillerkirche, den Schillerhof, das Schillergäßchen, die Friedrich-Schiller-Universität.
Auf dieser Homepage können Sie sich auf eine Reise durch Schillers Jena begeben und seinen Spuren in der Stadt nachgehen. Klicken Sie auf die Punkte des interaktiven Stadtplans und reisen Sie zurück in das Jena des ausgehenden 18. Jahrhunderts.

Die Frage stammt aus Schillers Schrift Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, die 1795 in seinen Horen erscheint.
In dieser Schrift tritt Schiller nicht nur als ein Kulturkritiker in Erscheinung, sondern auch als ein Theoretiker des Schönen, dem es um eine praktische Ausrichtung dieser Theorie, um eine „Philosophie des schönen Umgangs“, geht.
(Mai 1794 – April 1795): Unterm Markt 1 (zerstört 1945), heute Geschäfts- und Wohnhaus
Die Frage stammt aus Schillers Schrift Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, die 1795 in seinen Horen erscheint.
In dieser Schrift tritt Schiller nicht nur als ein Kulturkritiker in Erscheinung, sondern auch als ein Theoretiker des Schönen, dem es um eine praktische Ausrichtung dieser Theorie, um eine „Philosophie des schönen Umgangs“, geht.
Indem er sich implizit auf Kant beruft, stellt Schiller im achten Brief fest, dass das gegenwärtige „Zeitalter“ durchaus ein „aufgeklärt[es]“ sei. Diesem Postulat steht jedoch entgegen, dass sich aktuell noch immer die „allgemeine Herrschaft der Vorurtheile und diese Verfinsterung der Köpfe“ wahrnehmen lasse. Wie aber ist dieser Widerspruch zu lösen? Schiller legt dar, dass die Aufklärung des Verstandes nicht hinreiche, um der Idee von einem ‚aufgeklärten Zeitalter‘ gerecht zu werden.
weiterDenn die „Ausbildung des< Empfindungsvermögens“ sei „das dringendere Bedürfniß der Zeit“, da erst die Balance von Kopf und Herz – bzw. in Schillers Terminologie: von Form- und Stofftrieb – die Ausbildung des harmonischen, sich seiner Ganzheit bewussten Menschen ermögliche.
Schillers „Philosophie des schönen Umgangs“ lässt sich mit seinem Barbarenbegriff kontrastieren. Der Ausdruck bárbaros wurde im Griechischen zum einen als Abwertung des ‚ausländisch-fremdsprachigen‘ Wilden, zum anderen als allgemeine Bezeichnung für einen ‚rohen‘ Menschen gebraucht. Der antike Sprachgebrauch führt also sowohl eine Aversion gegen das Äußere (die ‚Barbarenvölker’), als auch eine innere Abgrenzung (menschliche Barbarei) mit sich. Schillers Begriff des Barbaren in den Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen ist dem letzteren Gebrauch zuzuordnen. Gegen alle Formen der menschlichen Barbarei bringt Schiller in den Briefen von 1795 die Ausbildung des Verstandes- und Empfindungsvermögens in Stellung. Die ästhetische Bildung wird zum Heilmittel gegen das Verfehlen des Menschlichen überhaupt.
weiter zurückUm 1800 gibt es durchaus Alternativen zu diesem Konzept. So wird Kant drei Jahre später in seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht einen anderen Ausweg aus der Barbarei suchen, indem er auf eine Balance zwischen individueller Freiheit und Gesetz drängt.
Schillers Frage, woran es denn liege, dass wir, trotz aller Zivilisationsleistungen, immer noch Barbaren sind, ist bis in unsere Gegenwart hinein nicht verstummt. Zunächst hat sie der Dichter Friedrich Hölderlin 1799 in der berühmten Scheltrede der Deutschen aufgegriffen, die er seinem Roman Hyperion einfügt:„Barbaren von Alters her“, heißt es dort über die Deutschen,
„durch Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer geworden, tiefunfähig jedes göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mark zum Glük der heiligen Grazien, in jedem Grad der Übertreibung und der Ärmlichkeit belaidigend für jede gutgeartete Seele, dumpf und harmonielos, wie die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes – das, mein Bellarmin! waren meine Tröster.“weiter zurück
Die Frage hat im 20. Jahrhundert, angesichts der Zivilisationsbrüche totalitärer Herrschaft , eine herausfordernde Aktualität besessen. Wir hören sie, wenn Walter Benjamin über die Verstrickung von Kultur und Barbarei reflektiert, wenn Theodor W. Adorno danach forscht, welche Kräfte die Gesellschaft zur Barbarei hinsteuern.
In der Dialektik der Aufklärung, gemeinsam mit Max Horkheimer verfasst, fragen die Autoren 1944 danach, warum die Menschheit, „anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt“.
 zurück
weiter
zurück
weiter
Schiller formulierte sie an einem Ort, der eben dieser Rohheit zum Opfer fallen sollte. Die Rede ist vom sog. „Kirstenschen Haus“ am Markt, das 1945 in den Kriegswirren zerstört wurde. Das Haus stand in der südöstlichsten Ecke des Marktes, wo sich heute ein Wohn- und Geschäftshaus befindet. Es war ein Professorenhaus, ausgestattet mit einem Hörsaal, den Schiller aber nicht nutzte. Hier fand Ende Juli 1794 jenes „Glückliche Ereigniß“ seine unmittelbare Fortsetzung, dass kurz zuvor in der Rathausgasse 1 nach einer Tagung der Naturforschenden Gesellschaft seinen Anfang nahm: das erste intensive Gespräch zwischen Schiller und Goethe, das letzterer später zur Geburtsstunde des bis 1805 währenden Freundschaftsbundes stilisierte.
 zurück
zurück
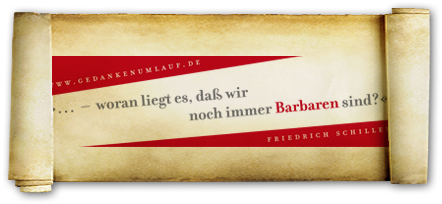

Das Xenion mit dem Titel Gelehrte Gesellschaft oder G.G., wie es in der Endfassung heißt, entsteht zusammen mit mehr als 1.000 seiner Art in den Jahren 1795/96. Solche „Gastgeschenke“, die Schiller gegenüber seinem engen Vertrauten Körner als „eine wahre poetische Teufeley“ ankündigt, häufen sich zu einem satirischen Großprojekt Goethes und Schillers an.
(April 1795-Dezember 1799): Löbdergraben 15 a (zerstört 1945), heute Universitätsgebäude
Das Xenion mit dem Titel Gelehrte Gesellschaft oder G.G., wie es in der Endfassung heißt, entsteht zusammen mit mehr als 1.000 seiner Art in den Jahren 1795/96. Solche „Gastgeschenke“, die Schiller gegenüber seinem engen Vertrauten Körner als „eine wahre poetische Teufeley“ ankündigt, häufen sich zu einem satirischen Großprojekt Goethes und Schillers an. Gedruckt wurden 414 der bissigen Epigramme im Musen-Almanach für das Jahr 1797, was diesem später den Beinamen „Xenien-Almanach“ einbringt. Wenn auch das meiste darin als „wilde gottlose Satyre, besonders auf Schriftsteller und Schriftstellerische Produkte“ provoziert, warten die Xenien durchaus „mit einzelnen poetischen, auch philosophischen Gedankenblitzen“ auf, was im starken Echo der Angegriffenen allerdings nur schwach widerhallt.
weiterDie Veröffentlichung der Xenien führt von der „ Sensation“ zum Skandal. Gegner sparen nicht mit Superlativen, so etwa der Publizist August Adolph von Hennings (1746-1826), der die Xenien in seiner Monatsschrift Der Genius der Zeit als das „schändlichste […], welches wir in der deutschen Literatur haben“, brandmarkt. „In Corpore“, also als Gesamtheit, musste sich durch das Xenion jegliche „Gelehrte Gesellschaft“ angegriffen fühlen. Damit steht das Epigramm in der Tradition der Gelehrtenschelte, die so alt ist wie die Gelehrtenschaft selbst. Bemerkenswert ist die Pointe des Xenions: Es unterstellt eine Schwächung des intellektuellen Vermögens unter den Bedingungen einer Gruppendynamik. Auch dieser Gedanke ist nicht neu; er spricht sich beispielsweise im dem römischen Sinnspruch: „Senatores omnes boni viri, senatus romanus mala bestia“ (die Senatoren sind alle gute Männer, der römische Senat ist eine Bestie) aus. Dass sich menschliches Verhalten in Gruppen oder Massen gegenüber dem Individualverhalten verändert, wurde lange nach Schiller in der theoretischen Fundierung der sogenannten Massenpsychologie untersucht.
weiter zurückWas Gustave Le Bon mit seinem Werk Psychologie der Massen begründete, entwickelte sich über Sigmund Freuds Massenpsychologie und Ich-Analyse von 1921 zu einem, vor allem sozialpsychologisch profilierten Thema, dem sich auch Literaten wie Hermann Broch (Massenwahntheorie, 1939-1948) und Elias Canetti (Masse und Macht, 1960) widmeten. Wenn der Sozialpsychologe Serge Moscovici 1981 in seinem Buch Das Zeitalter der Massen feststellt, dass „in einer Kollektivität […] die ersten die letzten sein“ werden, so nimmt er den Gedanken des Xenions der „Gelehrten Gesellschaft“ wieder auf und fasst ihn neu zusammen:
Für sich genommen, ist jeder von uns letzten Endes vernünftig; zusammen mit anderen, in einer Masse, bei einer politischen Versammlung, aber auch in einer Gruppe von Freunden, sind wir alle bereit, die schlimmsten Dummheiten zu begehen.weiter zurück
Das Xenion zur „Gelehrten Gesellschaft“ wird in einer Zeit verfasst, in der Schiller das „Griesbachsche Haus“ bewohnt, in dessen angrenzendem Hörsaal er 1789 seine Antrittsvorlesung gehalten hatte. Später, zwischen April 1795 und Dezember 1799, überlässt Griesbach Schillers Familie die beiden oberen Etagen als Wohnung. Hier beginnt der Dichter die Arbeiten an seinem Wallenstein, hier entstehen in dieser Zeit bekannte Gedichte wie Der Spaziergang oder Prosaschriften wie Die sentimentalischen Dichter.
 zurück
zurück
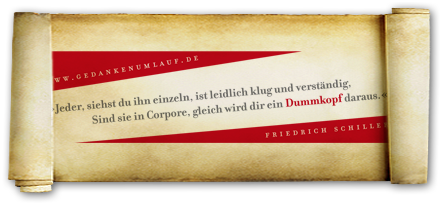

Schillers Antrittsvorlesung am Dienstag, den 26. Mai 1789, macht in jeder Hinsicht Epoche.
Noch Fichte und Schelling werden 1794 und 1799 in ihren Antrittsvorlesungen an Schiller anknüpfen. „Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?“, so lautet die Fragestellung, die der „Historiker“ Schiller behandelt.
Er will die Studenten für den Entwurf eines Wissenschaftsethos begeistern, für eine Universitätsausbildung, die auch im Medium des Geschichtsstudiums fachliche Kompetenz, persönliches Wachstum des Einzelnen und gesellschaftliche Verantwortung fördert.
(Mai 1789 – April 1793): Jenergasse 26 (zerstört 1943), heute nahe Café „Immergrün“
Gerade der Erfolg seiner Schrift Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung (1788) trägt Schiller eine außerordentliche, unbesoldete Professur in Jena ein. Lange vor jenem „Glücklichen Ereigniß“, das Schiller und Goethe im Sommer 1794 zueinander bringt, empfiehlt der Geheime Rat den gerade als Historiker aufgetretenen Dichter dem Consilium und damit seinem Landesherren Carl August mit den Worten: „Herr Friedrich Schiller, welchem Serenissimus vor einigen Jahren den Titel als Rath ertheilt, […] hat sich durch seine Schriften einen Nahmen erworben, besonders neuerdings durch eine Geschichte des Abfalls der Niederlande von der Spanische Regierung Hoffnung gegeben, daß er das historische Fach mit Glück bearbeiten werde.“ Die Weimarer Regierung beruft Schiller daraufhin. Der Geehrte hat einige Not, sich über dieses Angebot zu freuen.
weiterGegenüber seinem Intimfreund Körner bekennt er: „die Herrn wißen alle nicht, wie wenig Gelehrsamkeit bei mir vorauszusetzen ist.“ Schiller ist kein Historiker, jedenfalls keiner vom Fach, dennoch nimmt er die Herausforderung an und kommt nach Jena. Bei den Schwestern Schramm, die eine Pension („Schrammei“) betreiben, bezieht er drei Räume.
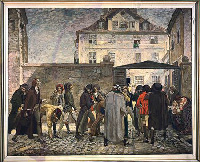
Schillers Antrittsvorlesung am Dienstag, den 26. Mai 1789, macht in jeder Hinsicht Epoche. Noch Fichte und Schelling werden 1794 und 1799 in ihren Antrittsvorlesungen an Schiller anknüpfen.
weiter zurück„Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?“, so lautet die Fragestellung, die der „Historiker“ Schiller behandelt. Er will die Studenten für den Entwurf eines Wissenschaftsethos begeistern, für eine Universitätsausbildung, die auch im Medium des Geschichtsstudiums fachliche Kompetenz, persönliches Wachstum des Einzelnen und gesellschaftliche Verantwortung fördert.
Mit welcher ‚Haltung’ betreiben wir Wissenschaft, mit welcher ‚Haltung’ führen wir unser Leben? In welchem Verhältnis stehen Leben und Wissenschaft zueinander? In welchem Verhältnis steht die Endlichkeit unserer individuellen Lebenszeit zur Zeit der menschlichen Gattungsgeschichte? In welchem Verhältnis stehen die Generationen untereinander?
 weiter
zurück
weiter
zurück
Nach Schiller haben sich alle vorhergehenden Zeitalter „ohne es zu wissen oder zu erzielen“ – angestrengt, „unser menschliches Jahrhundert herbey zu führen“. Auch der Universalhistoriker Schiller will dazu beitragen, das historische „Vermächtniß von Wahrheit, Sittlichkeit und Freyheit“ zu vermehren und damit „an das kommende Geschlecht die Schuld zu entrichten, die er dem vergangenen nicht mehr abtragen kann“.
Die Vorlesung machte einen gewaltigen und nachhaltigen Eindruck in der Stadt. An Christian Gottfried Körner schreibt Schiller – unmittelbar nach den ersten beiden Vorlesungen – am 28. Mai:
„Vorgestern als den 26sten habe ich endlich das Abentheuer auf dem Katheder rühmlich und tapfer bestanden, und gleich gestern wiederhohlt. Ich lese nur 2mal in der Woche und zwey Tage hintereinander, so daß ich 5 Tage ganz frey behalte.
weiter zurückDas Reinholdische Auditorium bestimmte ich zu meinem Debut. Es hat eine mäßige Größe und kann ohngefehr 80 sitzende Menschen, etwas über 100 in allem faßen; ob es nun freilich wahrscheinlich genug war, daß meine erste Vorlesung, der Neugierde wegen, eine größre Menge Studenten herbeylocken würde, so kennst Du ja meine Bescheidenheit. Ich wollte die größte Menge nicht gerade voraussetzen indem ich gleich mit dem größten Auditorium debutirte. Diese Bescheidenheit ist auf eine für mich sehr brillante Art belohnt worden. Meine Stunden sind Abends von 6 biß 7. Halb 6 war das Auditorium voll. Ich sah aus Reinholds Fenster Trupp über Trupp die Straße heraufkommen, welches gar kein Ende nehmen wollte. Ob ich gleich nicht ganz frey von Furcht war, so hatte ich doch an der wachsenden Anzahl Vergnügen und mein Muth nahm ehr zu. Ueberhaupt hatte ich mich mit einer gewißen Festigkeit gestählt, wozu die Idee, daß meine Vorlesung mit keiner andern die auf irgend einem Catheder in Jena gehalten worden die Vergleichung zu scheuen brauchen würde, und überhaupt die Idee von allen die mich hören, als der Überlegene anerkannt zu werden, nicht wenig beytrug.
weiter zurückAber die Menge wuchs nach und nach so, daß Vorsaal Flur und Treppe voll gedrängt waren und ganze Haufen wieder giengen. Jezt fiel es einem der bey mir war ein, ob ich nicht noch für diese Vorlesung ein anderes Auditorium wählen sollte. Grießbachs Schwager war gerade unter den Studenten, ich ließ ihnen also den Vorschlag thun bei Grießbach zu lesen und mit Freuden ward er aufgenommen. Nun gabs das lustigste Schauspiel. Alles stürzte hinaus und in einem heilen Zug die Johannisstraße hinunter, die eine der längsten in Jena, von Studenten ganz besät war. Weil sie liefen was sie konnten, um in Grießbachs Auditorium einen guten Platz zu bekommen, so kam die Straße in Allarme, und alles an den Fenstern in Bewegung. Man glaubte anfangs es wäre Feuerlerm und am Schloß kam die Wache in Bewegung. Was ists denn? Was gibts denn? hieß es überal. Da rief man denn! Der neue Profeßor wird lesen. Du siehst, daß der Zufall selbst dazu beytrug, meinen Anfang recht brillant zu machen. Ich folgte in einer kleinen Weile von Reinhold begleitet nach, es war mir als wenn ich durch die Stadt, die ich fast ganz durchzuwandern hatte, Spießruthen liefe.
weiter zurückGrießbachs Auditorium ist das größte und kann, wenn es voll gedrängt ist zwischen 3 und 400 Menschen faßen. Voll war es dießmal und so sehr daß ein Vorsaal und noch die Flur biß an die Hausthüre besetzt war, und im Auditorium selbst viele sich auf die Subsellien stellten. Ich zog also durch eine Allee von Zuschauern und Zuhörern ein und konnte den Katheder kaum finden, unter lautem Pochen, welches hier für Beyfall gilt, bestieg ich ihn und sah mich von einem Amphitheater von Menschen umgeben. So schwühl der Saal war, so erträglich wars am Catheder, wo alle Fenster offen waren und ich hatte doch frischen Odem. Mit den zehn ersten Worten, die ich selbst noch fest aussprechen konnte, war ich im ganzen Besitz meiner Contenance, und ich las mit einer Stärke und Sicherheit der Stimme, die mich selbst überraschte. Vor der Thüre konnte man mich noch recht gut hören. Meine Vorlesung machte Eindruck, den ganzen Abend hörte man in der Stadt davon reden und mir wiederfuhr eine Aufmerksamkeit von den Studenten, die bey einem neuen Profeßor das erste Beispiel war. Ich bekam eine Nachtmusik und Vivat wurde 3mal gerufen“.
zurück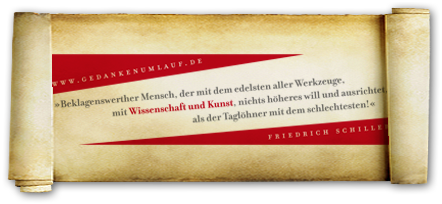

Friedrich Schiller – Dichter, Professor, Namenspatron
Daß der Name Friedrich Schillers untrennbar mit der Stadt Jena und ihrer Universität verbunden ist, wird nicht jedem Besucher auf den ersten Blick klar, denn es fehlen markante Hinweise darauf, daß der Dichter und Denker in seinem sogenannten ‚Jenaer Jahrzehnt‘ (1789 bis 1799) maßgeblichen Einfluß auf das geistige Leben seiner Zeit übte. Heute ist in Jena nur Schillers Gartenhaus als Museum erhalten. Dieses Haus und sein Garten strömen den Geist der Vergangenheit aus. Zum 250. Geburtstag Schillers will die Friedrich-Schiller-Universität den Garten zum öffentlichen Raum machen. Denn es gibt keinen zweiten Ort in Deutschland, in dem so viele Schiller-Denkmale stehen.

Die Frage stammt aus Schillers Schrift Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, die 1795 in seinen Horen erscheint.
In dieser Schrift tritt Schiller nicht nur als ein Kulturkritiker in Erscheinung, sondern auch als ein Theoretiker des Schönen, dem es um eine praktische Ausrichtung dieser Theorie, um eine „Philosophie des schönen Umgangs“, geht.
(Mai 1794 – April 1795): Unterm Markt 1 (zerstört 1945), heute Geschäfts- und Wohnhaus
Die Frage stammt aus Schillers Schrift Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, die 1795 in seinen Horen erscheint.
In dieser Schrift tritt Schiller nicht nur als ein Kulturkritiker in Erscheinung, sondern auch als ein Theoretiker des Schönen, dem es um eine praktische Ausrichtung dieser Theorie, um eine „Philosophie des schönen Umgangs“, geht.
Indem er sich implizit auf Kant beruft, stellt Schiller im achten Brief fest, dass das gegenwärtige „Zeitalter“ durchaus ein „aufgeklärt[es]“ sei. Diesem Postulat steht jedoch entgegen, dass sich aktuell noch immer die „allgemeine Herrschaft der Vorurtheile und diese Verfinsterung der Köpfe“ wahrnehmen lasse. Wie aber ist dieser Widerspruch zu lösen? Schiller legt dar, dass die Aufklärung des Verstandes nicht hinreiche, um der Idee von einem ‚aufgeklärten Zeitalter‘ gerecht zu werden.
weiterDenn die „Ausbildung des< Empfindungsvermögens“ sei „das dringendere Bedürfniß der Zeit“, da erst die Balance von Kopf und Herz – bzw. in Schillers Terminologie: von Form- und Stofftrieb – die Ausbildung des harmonischen, sich seiner Ganzheit bewussten Menschen ermögliche.
Schillers „Philosophie des schönen Umgangs“ lässt sich mit seinem Barbarenbegriff kontrastieren. Der Ausdruck bárbaros wurde im Griechischen zum einen als Abwertung des ‚ausländisch-fremdsprachigen‘ Wilden, zum anderen als allgemeine Bezeichnung für einen ‚rohen‘ Menschen gebraucht. Der antike Sprachgebrauch führt also sowohl eine Aversion gegen das Äußere (die ‚Barbarenvölker’), als auch eine innere Abgrenzung (menschliche Barbarei) mit sich. Schillers Begriff des Barbaren in den Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen ist dem letzteren Gebrauch zuzuordnen. Gegen alle Formen der menschlichen Barbarei bringt Schiller in den Briefen von 1795 die Ausbildung des Verstandes- und Empfindungsvermögens in Stellung. Die ästhetische Bildung wird zum Heilmittel gegen das Verfehlen des Menschlichen überhaupt.
weiter zurückUm 1800 gibt es durchaus Alternativen zu diesem Konzept. So wird Kant drei Jahre später in seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht einen anderen Ausweg aus der Barbarei suchen, indem er auf eine Balance zwischen individueller Freiheit und Gesetz drängt.
Schillers Frage, woran es denn liege, dass wir, trotz aller Zivilisationsleistungen, immer noch Barbaren sind, ist bis in unsere Gegenwart hinein nicht verstummt. Zunächst hat sie der Dichter Friedrich Hölderlin 1799 in der berühmten Scheltrede der Deutschen aufgegriffen, die er seinem Roman Hyperion einfügt:„Barbaren von Alters her“, heißt es dort über die Deutschen,
„durch Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer geworden, tiefunfähig jedes göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mark zum Glük der heiligen Grazien, in jedem Grad der Übertreibung und der Ärmlichkeit belaidigend für jede gutgeartete Seele, dumpf und harmonielos, wie die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes – das, mein Bellarmin! waren meine Tröster.“weiter zurück
Die Frage hat im 20. Jahrhundert, angesichts der Zivilisationsbrüche totalitärer Herrschaft , eine herausfordernde Aktualität besessen. Wir hören sie, wenn Walter Benjamin über die Verstrickung von Kultur und Barbarei reflektiert, wenn Theodor W. Adorno danach forscht, welche Kräfte die Gesellschaft zur Barbarei hinsteuern.
In der Dialektik der Aufklärung, gemeinsam mit Max Horkheimer verfasst, fragen die Autoren 1944 danach, warum die Menschheit, „anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt“.
 zurück
weiter
zurück
weiter
Schiller formulierte sie an einem Ort, der eben dieser Rohheit zum Opfer fallen sollte. Die Rede ist vom sog. „Kirstenschen Haus“ am Markt, das 1945 in den Kriegswirren zerstört wurde. Das Haus stand in der südöstlichsten Ecke des Marktes, wo sich heute ein Wohn- und Geschäftshaus befindet. Es war ein Professorenhaus, ausgestattet mit einem Hörsaal, den Schiller aber nicht nutzte. Hier fand Ende Juli 1794 jenes „Glückliche Ereigniß“ seine unmittelbare Fortsetzung, dass kurz zuvor in der Rathausgasse 1 nach einer Tagung der Naturforschenden Gesellschaft seinen Anfang nahm: das erste intensive Gespräch zwischen Schiller und Goethe, das letzterer später zur Geburtsstunde des bis 1805 währenden Freundschaftsbundes stilisierte.
 zurück
zurück
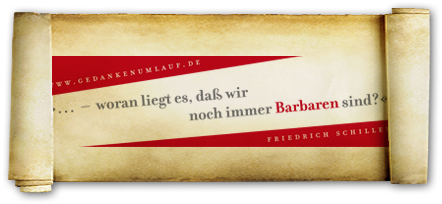

Das Xenion mit dem Titel Gelehrte Gesellschaft oder G.G., wie es in der Endfassung heißt, entsteht zusammen mit mehr als 1.000 seiner Art in den Jahren 1795/96. Solche „Gastgeschenke“, die Schiller gegenüber seinem engen Vertrauten Körner als „eine wahre poetische Teufeley“ ankündigt, häufen sich zu einem satirischen Großprojekt Goethes und Schillers an.
(April 1795-Dezember 1799): Löbdergraben 15 a (zerstört 1945), heute Universitätsgebäude
Das Xenion mit dem Titel Gelehrte Gesellschaft oder G.G., wie es in der Endfassung heißt, entsteht zusammen mit mehr als 1.000 seiner Art in den Jahren 1795/96. Solche „Gastgeschenke“, die Schiller gegenüber seinem engen Vertrauten Körner als „eine wahre poetische Teufeley“ ankündigt, häufen sich zu einem satirischen Großprojekt Goethes und Schillers an. Gedruckt wurden 414 der bissigen Epigramme im Musen-Almanach für das Jahr 1797, was diesem später den Beinamen „Xenien-Almanach“ einbringt. Wenn auch das meiste darin als „wilde gottlose Satyre, besonders auf Schriftsteller und Schriftstellerische Produkte“ provoziert, warten die Xenien durchaus „mit einzelnen poetischen, auch philosophischen Gedankenblitzen“ auf, was im starken Echo der Angegriffenen allerdings nur schwach widerhallt.
weiterDie Veröffentlichung der Xenien führt von der „ Sensation“ zum Skandal. Gegner sparen nicht mit Superlativen, so etwa der Publizist August Adolph von Hennings (1746-1826), der die Xenien in seiner Monatsschrift Der Genius der Zeit als das „schändlichste […], welches wir in der deutschen Literatur haben“, brandmarkt. „In Corpore“, also als Gesamtheit, musste sich durch das Xenion jegliche „Gelehrte Gesellschaft“ angegriffen fühlen. Damit steht das Epigramm in der Tradition der Gelehrtenschelte, die so alt ist wie die Gelehrtenschaft selbst. Bemerkenswert ist die Pointe des Xenions: Es unterstellt eine Schwächung des intellektuellen Vermögens unter den Bedingungen einer Gruppendynamik. Auch dieser Gedanke ist nicht neu; er spricht sich beispielsweise im dem römischen Sinnspruch: „Senatores omnes boni viri, senatus romanus mala bestia“ (die Senatoren sind alle gute Männer, der römische Senat ist eine Bestie) aus. Dass sich menschliches Verhalten in Gruppen oder Massen gegenüber dem Individualverhalten verändert, wurde lange nach Schiller in der theoretischen Fundierung der sogenannten Massenpsychologie untersucht.
weiter zurückWas Gustave Le Bon mit seinem Werk Psychologie der Massen begründete, entwickelte sich über Sigmund Freuds Massenpsychologie und Ich-Analyse von 1921 zu einem, vor allem sozialpsychologisch profilierten Thema, dem sich auch Literaten wie Hermann Broch (Massenwahntheorie, 1939-1948) und Elias Canetti (Masse und Macht, 1960) widmeten. Wenn der Sozialpsychologe Serge Moscovici 1981 in seinem Buch Das Zeitalter der Massen feststellt, dass „in einer Kollektivität […] die ersten die letzten sein“ werden, so nimmt er den Gedanken des Xenions der „Gelehrten Gesellschaft“ wieder auf und fasst ihn neu zusammen:
Für sich genommen, ist jeder von uns letzten Endes vernünftig; zusammen mit anderen, in einer Masse, bei einer politischen Versammlung, aber auch in einer Gruppe von Freunden, sind wir alle bereit, die schlimmsten Dummheiten zu begehen.weiter zurück
Das Xenion zur „Gelehrten Gesellschaft“ wird in einer Zeit verfasst, in der Schiller das „Griesbachsche Haus“ bewohnt, in dessen angrenzendem Hörsaal er 1789 seine Antrittsvorlesung gehalten hatte. Später, zwischen April 1795 und Dezember 1799, überlässt Griesbach Schillers Familie die beiden oberen Etagen als Wohnung. Hier beginnt der Dichter die Arbeiten an seinem Wallenstein, hier entstehen in dieser Zeit bekannte Gedichte wie Der Spaziergang oder Prosaschriften wie Die sentimentalischen Dichter.
 zurück
zurück
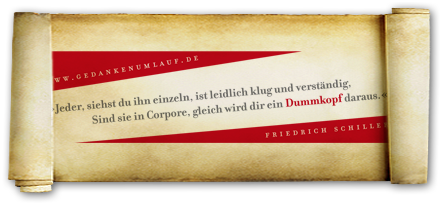

Schillers Antrittsvorlesung am Dienstag, den 26. Mai 1789, macht in jeder Hinsicht Epoche.
Noch Fichte und Schelling werden 1794 und 1799 in ihren Antrittsvorlesungen an Schiller anknüpfen. „Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?“, so lautet die Fragestellung, die der „Historiker“ Schiller behandelt.
Er will die Studenten für den Entwurf eines Wissenschaftsethos begeistern, für eine Universitätsausbildung, die auch im Medium des Geschichtsstudiums fachliche Kompetenz, persönliches Wachstum des Einzelnen und gesellschaftliche Verantwortung fördert.
(Mai 1789 – April 1793): Jenergasse 26 (zerstört 1943), heute nahe Café „Immergrün“
Gerade der Erfolg seiner Schrift Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung (1788) trägt Schiller eine außerordentliche, unbesoldete Professur in Jena ein. Lange vor jenem „Glücklichen Ereigniß“, das Schiller und Goethe im Sommer 1794 zueinander bringt, empfiehlt der Geheime Rat den gerade als Historiker aufgetretenen Dichter dem Consilium und damit seinem Landesherren Carl August mit den Worten: „Herr Friedrich Schiller, welchem Serenissimus vor einigen Jahren den Titel als Rath ertheilt, […] hat sich durch seine Schriften einen Nahmen erworben, besonders neuerdings durch eine Geschichte des Abfalls der Niederlande von der Spanische Regierung Hoffnung gegeben, daß er das historische Fach mit Glück bearbeiten werde.“ Die Weimarer Regierung beruft Schiller daraufhin. Der Geehrte hat einige Not, sich über dieses Angebot zu freuen.
weiterGegenüber seinem Intimfreund Körner bekennt er: „die Herrn wißen alle nicht, wie wenig Gelehrsamkeit bei mir vorauszusetzen ist.“ Schiller ist kein Historiker, jedenfalls keiner vom Fach, dennoch nimmt er die Herausforderung an und kommt nach Jena. Bei den Schwestern Schramm, die eine Pension („Schrammei“) betreiben, bezieht er drei Räume.
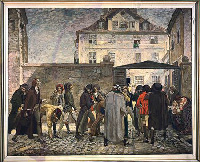
Schillers Antrittsvorlesung am Dienstag, den 26. Mai 1789, macht in jeder Hinsicht Epoche. Noch Fichte und Schelling werden 1794 und 1799 in ihren Antrittsvorlesungen an Schiller anknüpfen.
weiter zurück„Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?“, so lautet die Fragestellung, die der „Historiker“ Schiller behandelt. Er will die Studenten für den Entwurf eines Wissenschaftsethos begeistern, für eine Universitätsausbildung, die auch im Medium des Geschichtsstudiums fachliche Kompetenz, persönliches Wachstum des Einzelnen und gesellschaftliche Verantwortung fördert.
Mit welcher ‚Haltung’ betreiben wir Wissenschaft, mit welcher ‚Haltung’ führen wir unser Leben? In welchem Verhältnis stehen Leben und Wissenschaft zueinander? In welchem Verhältnis steht die Endlichkeit unserer individuellen Lebenszeit zur Zeit der menschlichen Gattungsgeschichte? In welchem Verhältnis stehen die Generationen untereinander?
 weiter
zurück
weiter
zurück
Nach Schiller haben sich alle vorhergehenden Zeitalter „ohne es zu wissen oder zu erzielen“ – angestrengt, „unser menschliches Jahrhundert herbey zu führen“. Auch der Universalhistoriker Schiller will dazu beitragen, das historische „Vermächtniß von Wahrheit, Sittlichkeit und Freyheit“ zu vermehren und damit „an das kommende Geschlecht die Schuld zu entrichten, die er dem vergangenen nicht mehr abtragen kann“.
Die Vorlesung machte einen gewaltigen und nachhaltigen Eindruck in der Stadt. An Christian Gottfried Körner schreibt Schiller – unmittelbar nach den ersten beiden Vorlesungen – am 28. Mai:
„Vorgestern als den 26sten habe ich endlich das Abentheuer auf dem Katheder rühmlich und tapfer bestanden, und gleich gestern wiederhohlt. Ich lese nur 2mal in der Woche und zwey Tage hintereinander, so daß ich 5 Tage ganz frey behalte.
weiter zurückDas Reinholdische Auditorium bestimmte ich zu meinem Debut. Es hat eine mäßige Größe und kann ohngefehr 80 sitzende Menschen, etwas über 100 in allem faßen; ob es nun freilich wahrscheinlich genug war, daß meine erste Vorlesung, der Neugierde wegen, eine größre Menge Studenten herbeylocken würde, so kennst Du ja meine Bescheidenheit. Ich wollte die größte Menge nicht gerade voraussetzen indem ich gleich mit dem größten Auditorium debutirte. Diese Bescheidenheit ist auf eine für mich sehr brillante Art belohnt worden. Meine Stunden sind Abends von 6 biß 7. Halb 6 war das Auditorium voll. Ich sah aus Reinholds Fenster Trupp über Trupp die Straße heraufkommen, welches gar kein Ende nehmen wollte. Ob ich gleich nicht ganz frey von Furcht war, so hatte ich doch an der wachsenden Anzahl Vergnügen und mein Muth nahm ehr zu. Ueberhaupt hatte ich mich mit einer gewißen Festigkeit gestählt, wozu die Idee, daß meine Vorlesung mit keiner andern die auf irgend einem Catheder in Jena gehalten worden die Vergleichung zu scheuen brauchen würde, und überhaupt die Idee von allen die mich hören, als der Überlegene anerkannt zu werden, nicht wenig beytrug.
weiter zurückAber die Menge wuchs nach und nach so, daß Vorsaal Flur und Treppe voll gedrängt waren und ganze Haufen wieder giengen. Jezt fiel es einem der bey mir war ein, ob ich nicht noch für diese Vorlesung ein anderes Auditorium wählen sollte. Grießbachs Schwager war gerade unter den Studenten, ich ließ ihnen also den Vorschlag thun bei Grießbach zu lesen und mit Freuden ward er aufgenommen. Nun gabs das lustigste Schauspiel. Alles stürzte hinaus und in einem heilen Zug die Johannisstraße hinunter, die eine der längsten in Jena, von Studenten ganz besät war. Weil sie liefen was sie konnten, um in Grießbachs Auditorium einen guten Platz zu bekommen, so kam die Straße in Allarme, und alles an den Fenstern in Bewegung. Man glaubte anfangs es wäre Feuerlerm und am Schloß kam die Wache in Bewegung. Was ists denn? Was gibts denn? hieß es überal. Da rief man denn! Der neue Profeßor wird lesen. Du siehst, daß der Zufall selbst dazu beytrug, meinen Anfang recht brillant zu machen. Ich folgte in einer kleinen Weile von Reinhold begleitet nach, es war mir als wenn ich durch die Stadt, die ich fast ganz durchzuwandern hatte, Spießruthen liefe.
weiter zurückGrießbachs Auditorium ist das größte und kann, wenn es voll gedrängt ist zwischen 3 und 400 Menschen faßen. Voll war es dießmal und so sehr daß ein Vorsaal und noch die Flur biß an die Hausthüre besetzt war, und im Auditorium selbst viele sich auf die Subsellien stellten. Ich zog also durch eine Allee von Zuschauern und Zuhörern ein und konnte den Katheder kaum finden, unter lautem Pochen, welches hier für Beyfall gilt, bestieg ich ihn und sah mich von einem Amphitheater von Menschen umgeben. So schwühl der Saal war, so erträglich wars am Catheder, wo alle Fenster offen waren und ich hatte doch frischen Odem. Mit den zehn ersten Worten, die ich selbst noch fest aussprechen konnte, war ich im ganzen Besitz meiner Contenance, und ich las mit einer Stärke und Sicherheit der Stimme, die mich selbst überraschte. Vor der Thüre konnte man mich noch recht gut hören. Meine Vorlesung machte Eindruck, den ganzen Abend hörte man in der Stadt davon reden und mir wiederfuhr eine Aufmerksamkeit von den Studenten, die bey einem neuen Profeßor das erste Beispiel war. Ich bekam eine Nachtmusik und Vivat wurde 3mal gerufen“.
zurück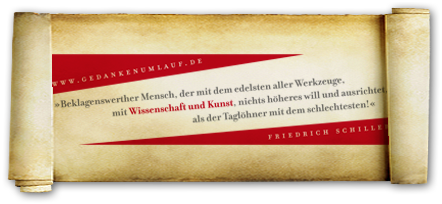

Mit dem ausgewählten Zitat wird entschieden für die Unabhängigkeit und Unbeschränktheit des menschlichen Denkens Partei ergriffen. Insbesondere der Begriff der ‚Knechtschaft‘ lässt sich als Synonym jener „Unmündigkeit“ begreifen, die der Einzelne, so Kant, aufgrund seiner intellektuellen Faulheit selbst verschuldet habe. Auf dieser Grundlage plädiert Schiller für die größtmögliche Freiheit der Vernunft: Erst aus der Emanzipation von bestehenden theoretischen Vorgaben kann sich die denkerische Produktivität entfalten.
(April – August 1793): Zwätzengasse 9 (Umbau 1872), heute Philosophisches Institut
Schillers Brief vom 13. Juli 1793 gehört zu den sogenannten Augustenburger Briefen, die er zwischen Februar und Dezember 1793 an seinen Mäzen, den Prinzen Friedrich Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, richtet. Gemeinsam mit dem Grafen Ernst Heinrich Schimmelmann hatte dieser ein dreijähriges Stipendium von 3.000 Talern bereitgestellt, nachdem ihm Schillers schwere Erkrankung und finanzielle Notlage bekannt geworden war. Schiller, der nun die Möglichkeit hat, mit der nötigen „Unabhängigkeit des Geistes“ sich einem intensiven Kant-Studium zu widmen , revanchiert sich im Verlauf des Jahres 1793 mit sechs Briefen an den Prinzen von Augustenburg, in denen er Rechenschaft über seine kunstphilosophische Tätigkeit der letzten Jahre ablegt. In überarbeiteter Form werden die Briefe 1795 unter dem Titel Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen in Schillers Zeitschrift Die Horen veröffentlicht.
weiterDer Prinz von Augustenburg hatte erklärt, kein Kant-Kenner und auch kein „SystemMann“ bzw. „philosophischer Gelehrter“ zu sein. Auf diese Bekundung grundsätzlicher Unvoreingenommenheit reagiert Schiller mit der Versicherung, daß er „unabhängig von jedem System bloß [s]einer eigenen Ueberzeugung […] folgen“ wolle. Schillers theoretische Reflexionen nehmen zwar ihren Ausgangspunkt bei Kant, er bewahrt sich jedoch die intellektuelle Freiheit, die Vorgaben kritisch zu mustern und selbständig zu erweitern. Dies geschieht etwa im Hinblick auf die Philosophie des Schönen, die Schiller zunächst in deutlicher Anlehnung an Kants Kritik der Urteilskraft entwickelt, die er in der Folge aber eigenständig auf die wirkmächtige Formel hin ausrichtete: „Schönheit also ist nichts anders als Freiheit in der Erscheinung“.
weiter zurückMit dem ausgewählten Zitat wird entschieden für die Unabhängigkeit und Unbeschränktheit des menschlichen Denkens Partei ergriffen. Insbesondere der Begriff der ‚Knechtschaft‘ lässt sich als Synonym jener „Unmündigkeit“ begreifen, die der Einzelne, so Kant, aufgrund seiner intellektuellen Faulheit selbst verschuldet habe. Auf dieser Grundlage plädiert Schiller für die größtmögliche Freiheit der Vernunft: Erst aus der Emanzipation von bestehenden theoretischen Vorgaben kann sich die denkerische Produktivität entfalten.
 weiter
zurück
weiter
zurück
Daß Schiller in der Zeit vom April bis August 1793 im Gartenhaus von Carl Christian Erhard Schmid wohnt – heute Zwätzengasse 9 –, ist nicht mit Gewissheit verbürgt. Am 7. April 1793 teilt Schiller zwar seinem Leipziger Freund Christian Friedrich Körner mit, daß er „endlich“ den geplanten „Auszug in den Garten“ vollzogen habe. Fraglich ist jedoch, ob sich dieser Garten tatsächlich in der Zwätzengasse 9 befunden hat, da es für diese Annahme keinen Beleg gibt. Gesichert ist dagegen, daß Schiller vier Monate in diesem „Garten“ verbringt, bevor er eine Reise in die schwäbische Heimat antritt.
zurück